Geschichte der Galerieholländer-Windmühle in Stroit
1842 beginnt die Geschichte der Windmühle in Stroit. Vorher musste das Getreide zum Mahlen nach Greene oder Voldagsen gebracht werden. Müller Grote aus Ahlshausen stellt beim Herzog von Braunschweig 1842 den Antrag, auf dem Rotenberge bei Stroit eine Mühle zu bauen. Das Ministerium in Braunschweig genehmigt den Mühlenbau und Grote baut eine Bockwindmühle. Diese brennt 1849 ab. Müller Grote baut sofort eine neue Mühle, die 1850 fertig ist. Diese Mühle ist eine Haubenwindmühle (Galerie-Holländer) aus massiven Backsteinen. Die Leistung der Mühle ist bemerkenswert: neben den beiden Getreide-Mahlgängen wird auch ein Ölgang und ein Graupengang installiert. Grote hatte sich durch diesen Bau verschuldet. Er verschwand nach Amerika. Die Mühle wechselte danach mehrfach den Besitzer. Seit 1930 arbeitet die Mühle ohne Wind mit einem E-Motor. Etwa 1960 wurde der Betrieb eingestellt, weil der Müller keine Arbeit mehr hatte. Die Mühle war seitdem vom Verfall bedroht.
Die Stroiter Windmühle ist ein imposanter Backsteinbau mit einer Höhe von etwa 22 Metern. Sie ist die höchstgelegene Windmühle im südlichen Niedersachsen (ca. 240 m ü. d. Meeresspiegel).
Ein Förderverein (Förderverein Stroiter Mühle e. V.) kümmert sich seit 1985 um den Erhalt der Mühle.
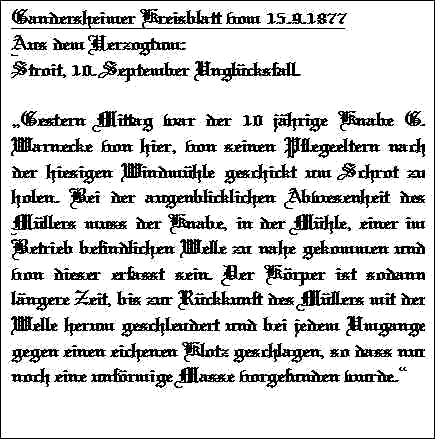
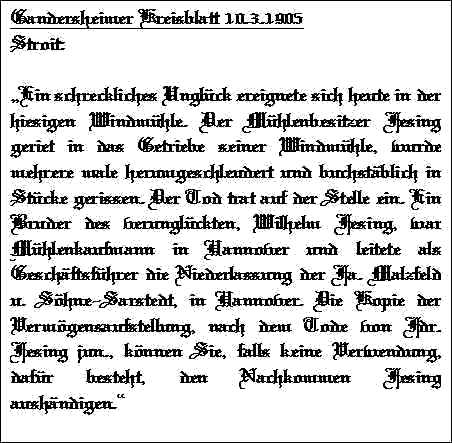
Um 1842 begann der Windmüller Heinrich Grote aus Ahlshausen mit den Vorbereitungen zum Bau einer Bockwindmühle auf der Stroiter Flur. Die Steine für die Grundmauern wurden vom Steinbrecher Messerschmidt gebrochen. Als Baumeister wirkte der Maurermeister Warnecke aus Ammensen, der etwa 30.000 Barrensteine vermauerte. Ebenfalls am Bau beteiligt war der Geschirrbauer Glenewinkel Delligsen (vermutlich Gerüstbauer ?). Der Name des eigentlichen Planers und Mühlenbauers wird in den Akten nicht genannt.
Grotes zweite Ehefrau brachte einen 3/4 Spännerhof in Ahlshausen mit in die Ehe, damit fiel dem aus Bierbergen, Landkreis Peine, stammenden Grote auch der Titel Ackermann zu. Ausgestattet mit diesem Grundbesitz konnte er zunächst einiges in die Waagschale werfen. Der Neubau einer Mühle hing, vor der Einführung der Gewerbefreiheit 1866, von der Zustimmung des Landesherren bzw. seiner Vertreter ab. Dazu musste der Antragsteller in öffentlichen Ankündigungen, durch Zeitungsanzeigen, der Nachbarschaft seine Absicht kund tun, um eventuelle Einsprüche der Anlieger abzuwarten. Die Müller Warnecke (Greene) und Küster (Voldagsen) erhoben sofort Einspruch mit der Forderung diesen Bau überhaupt zu verbieten. Zum Verbot kam es nun allerdings nicht, hingegen führten Warnecke und Küster mit der Staatsregierung einen fast sieben Jahre dauernden Prozess über die Höhe einer Entschädigung für entstandene Einnahmeverluste durch Grotes Mühlenbau. Um den Prozess nicht weiter ausufern zu lassen stimmten die Kontrahenten schließlich einem mageren Vergleich zu. Während des Prozesses stellte die herzogliche Regierung sehr detaillierte Untersuchungen über die Frequentierung der einzelnen benachbarten Mühlen an, unter Einbeziehung der auf den Hannoverschen Mühlen gemahlenen Mengen, ermittelt durch die Nebenzollämter Mühlenbeck und Delligsen. Älteren Erbzinsmühlen stand nach einem Gesetz von 1840 für den Verlust der Kundschaft durch neuerbaute Mühlen eine von Fall zu Fall festzusetzende Entschädigung zu. Grote weigerte sich standhaft und mit Erfolg, unter Berufung auf andere Paragraphen dieses Gesetzes, eine Entschädigung zu zahlen.
Seinem Plane folgend erwarb er 1843 von der Gemeinde Stroit etwa 2 Morgen und vom Großköter Ebrecht etwa 4 Morgen Land im Rosensieksfelde auf dem Rothenberge, unweit der heutigen B3 und baute darauf eine Bockwindmühle sowie ein Anbauerhaus. Am 25.8.1843 erhielt er die Konzession zum Betrieb der Bockwindmühle mit einem Mahl- sowie einem Schrotgang. Ein langes Dasein war dieser Bockmühle nicht beschieden, denn sie brannte in der Nacht vom 31.Mai zum 1.Juni 1849 vollkommen ab. Der Greener Justizamtmann vermutete sogar Brandstiftung, führte aber keine weiter führenden Untersuchungen durch. Die als Sachverständige hinzugezogenen Amtsmaurer- und Zimmermeister stellten Totalschaden fest und empfahlen die Auszahlung der Versicherungssumme von 2000 Thalern an den Geschädigten. Grote erbaute nun, anstelle der Bockwindmühle, einen stattlichen Galerieholländer mit 4 Etagen und einer Höhe von etwa 21 Metern. Dabei überschätzte er wohl erheblich seine finanziellen Möglichkeiten und die mit wechselnden Auslastungen verbundenen, erzielbaren Gewinne zur Abdeckung der Zinsen für die aufgenommenen Kapitalien.
Auch der heutige Besucher kann dem Baumeister, dessen Name in den Akten nicht festgehalten wurde, die Achtung nicht verwehren. Galerieholländer gehören zu den seltenen Bauwerken im niedersächsischen Hügelland, da ihr Hauptverbreitungsgebiet eigentlich in den norddeutschen Küstenregionen liegt. Um eine bessere Auslastung der Windkraft in der neuen Mühle zu erreichen beabsichtigte Grote zusätzlich einen Öl- und Graupengang einzubauen. Dazu musste zunächst das umständliche behördliche Genehmigungsverfah- ren, mit zu erwartenden Einsprüchen der Umlieger, in Gang gesetzt werden. Zu den weiteren Aktivitäten Grotes gehörte der Ankauf des Großkothofes Helmke Nr.ass.7. in Stroit, finanziert mit Krediten des Hauptgläu- bigers Pastor Henneberg in Brunsen. Mit einer Umschreibung der Besitztitel durch Zusammenlegung der Ländereien des Großkothofes auf das Mühlenanwesen gedachte Grote die Effizienz seiner Landwirtschaft vom Mühlengrundstück Nr.ass.57 aus entsprechend zu steigern. Dieses Vorhaben scheiterte am Einspruch der Gläubiger.
Grotes abenteuerlicher Plan in Garlebsen eine Wassermühle mit zwei Gängen zu errichten ging nicht mehr in Erfüllung. Durch den Abfall der Getreidepreise verschlechterten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse sowohl für die Landwirtschaft als auch für Mühlenbetriebe die über wenig Eigenkapital verfügten. Um einem Zusammenbruch seiner Unternehmungen zu entgehen, verließ Grote heimlich das Herzogtum und entwich, wie es so schön im Beamtendeutsch hieß, nach Amerika. Weder sein Name noch der seiner Familienangehörigen tauchte in den offiziellen Auswandererlisten auf. Eine Tochter aus erster Ehe wanderte bereits 1857 offiziell aus.
Inzwischen kümmerten sich ein von Grote eingesetzter Vermögensverwalter sowie ein gerichtlich bestellter Pfleger um die Grundstücke.
Um den Gläubigern zu ihrem Geld zu verhelfen sollte Grotes gleichnamiger Sohn, versehen mit einer Volljährigkeitserklärung, den Betrieb übernehmen. Am 20.8.1864 übertrug Grote sen. vom amerikanischen Domizil in Hancock, US Staat Michigan, am Südufer des oberen Sees gelegen, seinem ältesten Sohn die Besitzungen in Stroit einschließlich Mühle mit der Verpflichtung die Schulden abzutragen, seine Geschwister auszuzahlen und dem Vater bei einer eventuellen Rückkehr ein Altenteil zu sichern.
Grote jun. gelang es nicht den hohen Schuldenberg abzubauen. Etwa um 1867 hatte er vollkommen abgewirtschaftet.
Einen Einblick in die nun folgenden verworrenen Besitzverhältnisse gewährt ein späterer Bericht des Pastors Adjkt. Heinrich Dedekind aus Ellierode, der nach dem Tode seiner Stiefmutter, 1867, als Familienoberhaupt die Interessen seiner Halbgeschwister wahrnahm.
Danach übernahm zunächst der Hauptgläubiger Pastor, Henneberg aus Brunsen, den Besitz und verkaufte diesen weiter an die Witwe des Superintendenten Justus Dedekind, Charlotte Antoinette, geb. Warnecke früher Salzdahlum. Sie verstarb während der Übergabeverhandlungen am 8.10.1867 in Stroit. Als Erben traten nun auf, der Ökonom Carl Dedekind Stroit, die Ehefrau des Salineninspektors Grotrian, geb. Dedekind in Schöningen sowie die unverehelichte Marie Dedekind. 1868 wird der Ökonom Carl Dedekind als Besitzer des Großkothofes und der Windmühle eingetragen. Wahrscheinlich reichten weder seine Fähigkeiten noch seine Mittel aus um den Besitz zu halten. Die Gläubiger schlugen nun vor die Mühle unabhängig vom Kothof zu verkaufen um einen höheren Preis zu erzielen.
Mit einem Höchstgebot von 4350 Thalern erwarb der Müller Heinrich Kahlefeld aus Atzum am 29.3.1870 die Mühle nebst Wohnhaus sowie Nebengebäuden und etwa 6 Morgen Land. Auch Kahlefeld wurde dort nicht glücklich und verkaufte am 12.11.1872 an den aus Lebenstedt kommenden Mühlen-Pächter Friedrich Fesing. Diesem gelang es als Erstem einen ertragsfähigen Mühlenbetrieb aufzu-bauen. 1902 übernahm Fdr. Fesing jun. das Geschäft vom verstorbenen Vater und modernisierte den Betrieb durch Einbau von Elevatoren und einem Walzenstuhl. Leider verunglückte Fesing jun. 1905 tödlich durch einen Betriebsunfall in der Mühle. Seine Witwe verkaufte die Mühle, mit Ausnahme des Anbauerhauses und einigen Morgen Land 1906 an den Müller Richard Woitag. 1951 übernahm der jetzige Besitzer Robert Woitag den Betrieb.
Seit 1930 arbeitete die Mühle ohne Wind mit einem Elektro-Motor mit 12,5 PS.
Joachim Dette, Wolfenbüttel
Das Mühlensterben in den fünfziger Jahren machte auch vor der Stroiter Mühle nicht Halt; der Mahlbetrieb wurde 1962 eingestellt. Durch den Stillstand entstanden große Schäden an der Bausubstanz.
1970 stellte der Landkreis Gandersheim Gelder zur Verfügung für den Bau neuer Flügel, damit rückte die Stroiter Mühle wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Mühle steht 240m über dem Meeresspiegel und ist damit nicht nur Niedersachsens südlichste Windmühle, sondern auch die höchstgelegene.
1984 etablierte sich der Förderverein Stroiter Mühle e.V. und begann mit der Sanierung. Seither sind gut 350.000,-DM in die Renovierung geflossen. Rechtzeitig zum Tag des offenen Denkmals, am 12. September 1999, bekam die Mühle ein zweites mal neue Flügel. Instandgesetzt wurde auch das Kammrad in der Spitze, welches die Königswelle antreibt, die dann den Mühlenstein in Gang bringt.
Im Zwischengeschoss wurde mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Stroit ein schwerer Deckenbalken wieder eingezogen.
Die höchsten Kosten haben bisher die neue Galerie, das neue Windspiel und die Mauersanierung verursacht.
Die Windmühle steht unter Denkmalschutz. Sie liegt an der Bundesstraße 3, zwischen Alfeld und Einbeck und prägt das Landschaftsbild zwischen Hils und Selter.
Besichtigungen können unter folgender Telefonnummer vereinbart werden: 05565/ 451.
Prospekt der Mühle und Anmeldeformular für den Mühlenverein.
